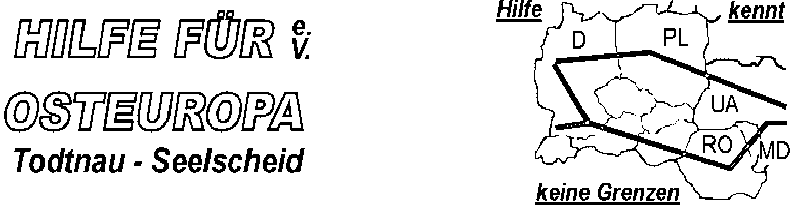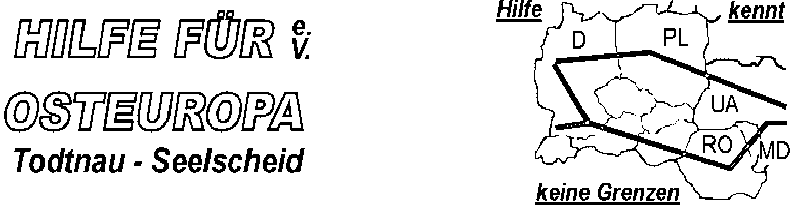|
Bericht über die Informations- und Vorbereitungsreise nach Rumänien vom 12.Oktober bis 21. Oktober 1999
Schon seit mehreren Wochen schiebe ich den zu schreibenden Reisebericht vor mir her, etwas hindert mich daran, einfach zu berichten, wie die
Informationsreise vom 12. bis 21. Oktober nach Rumänien verlaufen ist. Im Grunde genommen weiß ich, was mich daran hindert, nämlich die Tatsache, daß ich von keiner Besserung der Situation berichten kann, sondern
fast nur Negatives zu schreiben habe. Erst als ich diese Woche eine Basler Tageszeitung mit einem ausführlichen Bericht über die Situation in Rumänien in die Hände bekomme, habe ich das Gefühl mit meinen Erfahrungen
und Erlebnissen nicht alleine zu sein, da der Bericht mit unseren Eindrücken total identisch ist. Nur ganz selten hört oder liest man bei uns etwas über Rumänien. Moldavien - wo liegt das überhaupt? - werde ich oft
gefragt. Wie schnell vergißt man Menschen und Schicksale, wenn die Medien nicht darüber berichten. Vielleicht gelingt es mir mit diesem Bericht das Elend, bedingt durch die Verarmung, die immer weitere Teile der
Bevölkerung erfaßt, nachvollziehbar zu schildern.
Natürlich erleben wir auch schöne Momente, meine Schwägerin, mein Bruder und ich, die in diesem Bericht natürlich auch ihren Platz haben.
Das Flughafengebäude
in Bukarest ist nagelneu und auf das Modernste ausgestattet. Nur die Beamten sind noch die alten. In der Zeit, während wir in der Schlange stehen, um unsere Pässe kontrollieren zu lassen, könnten wir wieder nach
Zürich zurückfliegen. Dr. Nicolescu, der uns abholt, hatte die Wartezeit schon vorher einkalkuliert, er kennt schließlich die rumänischen Gepflogenheiten. Auf der Fahrt durch Bukarest versuche ich Veränderungen zu
bemerken. Die großen Prachtstraßen in Richtung Stadtmitte sind noch prachtvoller geworden, seit dem Besuch des Papstes im Mai. Die kleinen Nebensträßchen haben sich nicht groß verändert, es finden sich nach wie vor
Berge von Müll in der Gosse und tiefe Löcher im Asphalt. Zerlumpte Bettler nutzen die Grünphase der Ampeln, um die haltenden Autos abzuklappern, in der Hoffnung ein paar Lei zu bekommen. Streunende Hunde wechseln
bei dichtem Verkehr halsbrecherisch von einer Straßenseite zur anderen, und die Fassaden der im Jugendstil erbauten Häuser sind in einem viel schlechteren Zustand , als im vergangenen Jahr. Vorsichtig fragen wir Dr.
Nicolescu, wie es denn so geht, wie die derzeitige Situation ist, wohlwissend, was für eine Antwort zu erwarten ist. Schon die ernste Musik, die aus dem Autolautsprecher tönt, unterstreicht die gedrückte Stimmung .
"Wir versuchen zu überleben, wie schon seit vielen Jahren, aber nach 10 Jahren vergeblicher Hoffnung verliert man den Mut." Große Aufregung herrscht wegen der neuen Gesetzgebung im Gesundheitswesen. Zwar
war diese schon lange angekündigt, aber keiner weiß so recht wie alles laufen soll. Jahrzehntelang war man gewohnt, daß alles vom Staat diktiert und reglementiert wird. Alle staatlichen Ambulanzen wurden nun
privatisiert, die Ärzte müssen mit der Gesundheitskasse oder mit den Patienten abrechnen. Doch gleich zu Anfang hat man ein Budget festgelegt, je nach Patientenzahl des Arztes. So bekommt Herr Dr. Nicolescu z.B. im
Monat 600,00 DM, muß aber von diesem Betrag, Sprechstundenbedarf, Miete, Heizung, Personal und noch vieles mehr bezahlen. Nicht alle Betriebe zahlen den von den Arbeitnehmern zurück behaltenen Betrag in die
Gesundheitskasse ein, daher reicht das Geld, das die Ärzte für ihre Leistung bekommen sollen, hinten und vorne nicht. Sozialfälle müssen zudem umsonst behandelt werden. Dazu gehören unter anderem die Arbeitslosen
und Zigeuner. Junge Leute gehen kaum zum Arzt, weil sie sich die teuren Medikamente nicht leisten können. Frau Dr. Nicolescu, die sich eine Ambulanz mit einer Kollegin teilt , kann sich kaum zurückhalten ihre
Verbitterung und Hilflosigkeit zu zeigen, als wir bei ihr zu Hause ankommen. Nicht nur hier sondern auch an anderen Orten hört man immer wieder Bemerkungen, daß es solche Mißstände und solche Not in Zeiten der
Diktatur nicht gegeben hätte.
Ich vermisse bei der Ankunft vor dem Wohnblock, der jedes Jahr grauer aussieht, die große Anzahl von Hunden, die Dr. Nicolescu sonst immer freundlich begrüßen. Die meisten hat man
vergiftet, sie sind elend zugrunde gegangen, sagt er traurig. Er hatte immer ein Stückchen Brot für diese herrenlosen Geschöpfe in der Tasche.
Mein Bruder und meine Schwägerin beziehen für eine Nacht Quartier im
Haus der Deutschen Katholiken, bei Frau Fonosch, die schon seit Jahren Hilfsgüter von uns bekommt und diese sehr gewissenhaft verteilt. Von "Joschi", dem Hausmeister erfahren wir, daß der Ehemann von Frau
Fonosch vor ein paar Tagen ganz plötzlich verstorben sei. Sie ist derzeit bei ihrem Schwiegervater und wir können sie leider nicht treffen, was wir sehr bedauern.
Am nächsten Morgen machen wir einen kurzen Besuch
im Schillerhaus, dem Sitz des Deutschen Forums und werden von dem Vorsitzenden sehr gelobt für unsere treue und wertvolle Hilfe. Bei der anschließenden Visite im Kinderheim St. Josef treffen wir auf eine sehr
besorgte und deprimierte Frau Direktorin. Unter Tränen berichtet sie uns, daß sie nicht mehr weiß, wie sie die 55 Kinder zwischen 3 und 13 Jahren ernähren soll. Vom Staat erhält sie zur Zeit pro Kind pro Tag etwa
1.- DM, wovon alles bestritten werden muß, Kleidung, Nahrung, Heizung, Strom usw. Wegen hoher Schulden kann sie seit einiger Zeit keine Milch mehr für die Kinder kaufen. Nie bekommen sie alles, was wirklich zum
Leben notwendig ist. Überall bettelt sie um Lebensmittel, vom Staat bekommt sie keine Hilfe, nur für Spitzensportler seien genügend Gelder da, bemerkt sie voller Bitterkeit. Wir geben ihr einen Geldbetrag, der es
ihr ermöglicht, dringend nötige Lebensmittel, wenigstens für einen halben Monat, zu besorgen. Beim Abschied bedankt sie sich für das Geschenk des Himmels, wie sie sich ausdrückt. Drei Wochen später habe ich schon
einen Dankbrief und die Einkaufsquittungen auf meinem Schreibtisch liegen.
Mit dem Zug geht es nun weiter in Richtung Piatra-Neamts. Wir haben noch etwas Zeit und beobachten die Leute, die auf ihren Zug warten.
Nur wenige sind ordentlich gekleidet, ihre Gesichter sind grau und ernst. Kinder mit schmutzigen Gesichtchen, abgelaufenen Schuhen und teilweise zerrissener Kleidung laufen den Bahnsteig entlang und betteln. Man hat
das Gefühl, daß sie niemandem gehören, doch dann bemerkt man einen Mann, der sich im Hintergrund hält. Offensichtlich schickt er die Kinder zum Betteln und kassiert dann ein.
Es ist schon dunkel, als wir nach
angenehmer Fahrt (nur die Musik war wieder etwas aufdringlich) in Bacau ankommen. Gusti, die erst an diesem Morgen von ihrer anstrengenden Mission als Dolmetscherin des Priesterchors, der bei uns in Deutschland zu
Besuch war, nach Hause kam, läßt es sich nicht nehmen uns persönlich am Bahnhof abzuholen. Natürlich ist sie erschöpft, hat aber trotzdem das Bedürfnis ununterbrochen von ihrem Abenteuer in dem total überladenen Bus
zu berichten. Zum Essenvorbereiten ist sie an diesem Tag natürlich nicht gekommen, wir speisen zu später Stunde bei unsrer lieben Rosa, die sich unendlich über unseren Besuch freut (Rosa ist eine sehr liebenswerte
73- jährige Dame, die ich vor neun Jahren kennengelernt habe, als sie im Kinderheim für uns übersetzte).
Genau dem vorgegebenen Programm folgend, statten wir am nächsten Morgen dem Kinderheim einen Besuch ab.
Frau Dr. Vaileanu bedankt sich herzlich für die gebrachten Hilfsgüter, manche Probleme konnten damit gelöst werden. Die vor einem Jahr begonnenen Renovierungsarbeiten sind fortgeschritten, zur Beendigung fehlt das
nötige Geld. Der folgende Rundgang durch die Schlaf- und Aufenthaltsräume der Kinder macht besonders meiner Schwägerin, die das erstemal dabei ist, zu schaffen. Es ist nicht unordentlich, es riecht nur etwas streng,
aber das macht ja nichts. Es sind die vielen nur wenige Wochen alten Babys, die von ihren Müttern nach der Geburt in der Klinik zurückgelassen wurden und nun mitunter zu zweit in den Bettchen liegen, die die Augen
feucht werden lassen. Aber auch der Gedanke an das Schicksal der etwas Größeren, die nur eine Chance auf ein normales Leben haben, wenn sie adoptiert werden, geht uns sehr unter die Haut
Im Kinderheim, wo die
größeren Kinder untergebracht sind, hören wir, daß das von uns im vorigen Jahr gebrachte Sprachlabor sehr gute Dienste leistet, und die Kinder sehr gut lernen. Nicht mehr alle Kinder werden im Heim unterrichtet
sondern besuchen auch externe Schulen. Für den Unterricht bittet man uns gebrauchte Computer mitzubringen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben zu lernen mit solchen Geräten umzugehen.(bei uns haben teilweise
Kindergartenkinder schon eigene Computer und können sie bedienen).
Unser nächster Programmpunkt ist der Besuch bei dem Syndikat Fibrex, Savinesti. Seit 1992 versorgen wir die Ambulanz und Werksapotheke mit
Krankenhausbedarf und Medikamenten, die kostenlos an die Mitarbeiter und deren Angehörige gegen Rezept abgegeben werden. Bei dem Gespräch mit mehreren Direktoren blicken wir in sehr angstvolle und besorgte
Gesichter. Die Firma ist in großen Schwierigkeiten wegen mangelndem Absatz der erzeugten Produkte (Chemiefasern) und wegen geplanter, aber noch nicht vollzogener Übernahme durch ausländische Firmen. Von ehemals 14
000 Beschäftigten sind augenblicklich noch 3 900 übrig, aber es sollen noch mehr entlassen werden. Allein in den letzten drei Jahren ist das Bruttosozialprodukt um 20 Prozent geschrumpft, und ein Ende der Talfahrt
ist nicht abzusehen. Für die nächsten Tage hat man wegen der zu geringen Entlohnung und drohenden Kündigungen einen Generalstreik angekündigt. Ob wir diese Station auf unserer Liste bald streichen können? Ich
befürchte, ja.
Am nächsten Morgen treffen wir in der Präfektur den Präsidenten und die Direktorin der Kommission, die für den von Herrn Munteanu geleiteten Kinderhilfsfond für den Kreis Piatra-neamt zuständig
sind. Man berichtet uns von Reformen was die Betreuung und Finanzierung von Kinderheimen anbelangt. Neuerdings sind die Gemeinden zuständig für die Verwaltung der Heime im Land. Die Zentralregierung hat dabei
allerdings vergessen auch genügend Geld zur Verfügung zu stellen. Und aus der Sicht eines Bürgermeisters gibt es oft andere Prioritäten, als die knappen Mittel für verlassene oder behinderte Kinder auszugeben.
Inzwischen versucht man Sozialprogramme für Kinder durchzuführen, die in gefährdeten Familien leben. Anstelle von nüchternen Heimen soll ein System von präventiver Fürsorgeeinrichtungen, die von Sozialarbeitern
überwacht werden , und Pflegefamilien treten. Aber leider gibt es vom Staat zu wenig Geld, daher ist die Durchführung dieser Programme noch weit entfernt. Zum Schluß der Gespräche spricht man Herrn Munteanu und HFO
großen Dank für die geleistete Hilfe aus.
Nach kurzer Fahrt sind wir nun im Kinderheim "Romanita" in Roman angelangt, auf das wir sehr gespannt sind, da wir im letzten Jahr von einer Neugeborenenstation
hörten, wo es keine Heizung geben soll. In diesem Heim sind mehr als 120 Kinder im Alter zwischen 0 und 7 Jahren. Die meisten von ihnen sind Waisen, die anderen wurden ausgesetzt oder stammen aus zerrütteten
Familienverhältnissen. Die Direktorin begrüßt uns herzlich und dankt uns und Herrn Munteanu für die wertvolle Hilfe in den letzten Monaten. Vom Staat bekommt sie sehr wenig Unterstützung, da sie am Rande des Kreises
Neamt liegt, auch wurde erst am 15. Oktober der Lohn für August in Höhe von 47% ausbezahlt, die Löhne für September und Oktober fehlen noch. Man spürt, daß diese Dame sehr viel Liebe und Willenskraft hat, sie will
das Beste für diese bedauernswerten kleinen Menschenkinder. Die Kinder in den einzelnen Gruppen sind fröhlich, aber alle sehr blaß. Seit 1994 haben die Kinder keine Vitamine mehr erhalten. Das von uns im September
geschickte Medikament sei ein sehr wertvolles Vitamin, da man kein Fleisch und zuwenig Milch hat, um das Knochenwachstum zu fördern. Die Aufenthaltsräume sind teilweise ausgelegt mit von uns gebrachten Matratzen,
die die Kinder vor dem kalten Steinboden schützen. Auch freuen wir uns beim Anblick der bunten Decken, welche die fleißigen Strickfrauen aus Herrenschwand angefertigt haben. Was uns aber besonders freut, sind die
elektrischen Heizkörper, die wir beim letzten Transport mitgebracht haben. Im Feriendorf wurden sie im Frühjahr ausgebaut, alle noch funktionstüchtig, und uns zur Verfügung gestellt. Nun ist in jedem Raum mindestens
einer angebracht, und die Kinder müssen nicht mehr frieren. Natürlich haben wir uns an den nun anfallenden Stromkosten beteiligt. In diesem Heim ist noch viel zu sanieren, so kommt durch die Decke, wenn es regnet,
das Wasser. Die Wände sind feucht, die täglich anfallende Wäsche trocknet im Winter sehr schlecht. Man bittet uns um Wäschetrockner und Waschmaschinen. Im Übrigen haben wir in unserem Leben noch nie solch eine
Waschmaschine und Wäscheschleuder gesehen wie in diesem Kinderheim. Es handelt sich um total verrostete "Monstren" aus dem vorigen Jahrhundert. So etwas würde gerade mal in einem historischen Museum noch
einen Platz finden. In der Küche zeigt man uns stolz die Babynahrung von Milupa und lobt die Soßen der Firma Asal, die die größeren Kinder zu essen bekommen. Ganz begeistert ist man von den Haferflocken der Fa.
Kölln, die Kinder essen sie gern, und man kann allerlei Gerichte damit zaubern. Die Schlafräume sind sehr eng, aber sauber. In einem der Räume sind Kinder, die man irgendwo aufgelesen hat, zur Beobachtung
untergebracht. Im Raum daneben liegen schwerstbehinderte Kinder (das eine ist Spastiker und blind, das andere hat einen kürbisgroßen Wasserkopf ,und die Danebenliegenden sind in ähnlichem Zustand). Die Schwestern
gehen unheimlich lieb mit diesen bedauernswerten Wesen um, überhaupt scheint die Liebe zu diesen Kindern in diesem Heim an erster Stelle zu stehen. Tränen muß man hier nicht verbergen. Auf der Heimfahrt träume ich
davon dieses Heim irgendwann einmal sanieren zu können und die Kinder satt zu machen.
Zum Mittagessen sind wir in der katholischen Pfarrei eingeladen. Wir werden von einem ganz jungen Pfarrer empfangen, welcher
Pfarrer Budau, der nach Italien gereist ist, vertritt. Die fast 90-jährige Mutter serviert uns gekochten Fisch, denn es ist Freitag. Die leichte Mahlzeit schmeckt und tut uns sehr gut. Der junge Pfarrer bedankt sich
für die Spende, die wir für die Armen übergeben und hofft, daß wir uns wiedersehen.
Für unsre liebe Rosa ist es sehr anstrengend, denn wir nehmen sie auch jetzt mit in das Dorf Talba, wo wir den dortigen
katholischen Pfarrer besuchen wollen. Wir genießen auch hier frisch zubereiteten Fisch und neuen Wein. Gunther besichtigt den Platz, wo das Notstromaggregat, das wir im Mai mitgebracht haben, deponiert ist. Nicht so
ganz unseren Sicherheitsvorschriften entsprechend, meint er, aber wenn es funktioniert. Leider hatte der hiesige Zahnarzt kein Interesse am Einbau der Wasserpumpe, die wir im Mai mitgebracht haben, sie wird aber
aufbewahrt, bis sie eine sinnvolle Verwendung findet.
Bis jetzt habe ich noch gar nicht unseren lieben Zucu erwähnt, der uns, dank Fibrex, Savinesti, durch die Gegend fährt. Wir starten früh am Samstagmorgen in
Richtung Stausee, Tulghes, die psychiatrische Klinik ist unser Ziel. Gusti fährt mit ihrem eigenen Auto, da sie uns auf der nun beginnenden Rundreise nicht begleiten kann. Frau Dr. Moresanu freut sich sehr, als sie
uns empfängt, dennoch kann sie ihren Kummer nicht verbergen. Auch sie hat Riesenprobleme mit der Gesundheitsreform. Sie weiß nicht, wo das dringend benötigte Geld herkommen soll, wenn keine Unterstützung mehr vom
Staat kommt. Die Lage in allen Kinderbetreuungseinrichtungen haben sich 1999 erheblich verschlechtert, aber als besonders bedenklich wird die Lage in den Heimen für körperlich und geistig Behinderte und chronisch
Kranke bezeichnet. Das sowieso schon knappe Personal wurde aus finanziellen Gründen noch mehr reduziert. Unsere Organisation sei die einzige, die noch regelmäßig Hilfsgüter bringt, und diese Hilfe sei wirklich
Hilfe. Nach der Wende, vor zehn Jahren, kamen einige Male Hilfsorganisationen aus England und Holland. Doch inzwischen ist die anfängliche Welle der Solidarität wieder verebbt. Dringend bittet man uns um Wäsche,
Krankenhausbetten und Matratzen. Im Laufe der Zeit sind die von uns gebrachten Sachen unbrauchbar geworden, da von den 94 internierten Kindern 64 Bettnässer sind (die Erwachsenen nicht mit einbezogen), und daher die
Matratzen und Bettwäsche vom Urin dauernd aufgeweicht werden, auch die Betten beginnen zu rosten.
Der Rundgang durch zwei geschlossene Häuser zeigt riesiges Elend. Es ist kalt, nicht nur in den Räumen sondern
überhaupt. Die Wände sind leer, es fehlen Vorhänge an den Fenstern, der Fußboden ist aus kaltem Stein. Man erklärt uns, daß die Patienten alles sofort zerstören oder sogar aufessen würden, daher die kahlen Räume.
Die Kranken (hier eine Abteilung für Frauen) löffeln apathisch ihre Suppe aus kleinen Blechgefäßen. Auf den Betten liegen dünne Matratzen, die Deckbetten sind auch nicht für kalte Tage oder Nächte gedacht, die
Bettwäsche "strahlt" nicht in persilweiß sondern in mausgrau. Plötzlich steht wieder die kranke Frau, die uns im vorigen Jahr mit einem markerschütternden Schrei so sehr erschreckt hat, hinter uns. Ein
bißchen komisch ist mir schon zu Mute, als sie mich von oben bis unten mustert. Die Stationsschwester erkennt die Situation, denn die Patientin kann sehr aggressiv werden, und führt sie behutsam in ihr Zimmer. Wir
besuchen noch eine Station, wo größere und kleinere Kinder untergebracht sind. Es schlägt uns ein penetranter Geruch entgegen, wir halten uns nicht lange auf, ich denke es genügen die Eindrücke für heute. Meine
Schwägerin wird immer ruhiger, es geht ihr wie mir in den ersten Jahren. Man braucht sehr lange bis das alles verarbeitet ist.
Auf der Fahrt über die Paßhöhe in Richtung Tirgu-Mures fallen die ersten
Schneeflocken. Dr. Liebhart erwartet uns am Eingang der Stadt, und wir fahren erst einmal zu seinem Haus, das nach 7 Jahren Bauzeit endlich fertig ist. Wir übernachten wieder in der Pension vom Mai, wo Gunther seine
Socken "opfern" mußte (Raben hatten sie vom Fensterbrett geklaut).
Dr. Liebhart und Herr Goldner vom Forum der Deutschen nehmen sich den ganzen Tag Zeit um mit uns Gespräche zu führen, die Stadt zu
besichtigen und einen Rundgang durch die Klinik zu machen. Dr. Liebhart ist viel ruhiger als sonst, seit kurzem ist er nicht mehr Direktor der Klinik sondern nur noch Chef der Herzabteilung. Auch er klagt über die
Mißstände in der Klinik, die durch die Gesundheitsreform noch gravierender geworden sind. Herr Goldner berichtet von immer größeren Preissteigerungen besonders bei Heizung und Mieten, die von vielen nicht mehr
bezahlt werden können. Da bereits diese beiden Posten die Einnahmen durch Lohn oder Rente übersteigen, ist es fast unmöglich auch noch Medikamente, Nahrungsmittel oder gar Kleidung zu kaufen. Viele Familien bewohnen
nur noch einen Raum, die Heizung wird abgestellt. Es sind auch Fälle bekannt, wo die Bewohner die Wohnung verlassen haben und nun in einem leerstehenden Eisenbahnwagen leben. In der Zeitung konnte man sogar lesen,
daß eine 11-köpfige Familie in einer öffentlichen Toilette angetroffen wurde, die doch ein bißchen mehr Wärme zu bieten hatte als die freie Natur im Winter. Im Allgemeinen spürt man auch hier die zunehmende
Hoffnungslosigkeit. Die erwachsenen Söhne der beiden tragen sich mit dem Gedanken auszuwandern, was die beiden Väter durchaus verstehen. Eine Zukunft haben die jungen Leute in diesem kaputten Land bestimmt nicht.
Dr. Liebhart und Herr Goldner hätten als Deutschstämmige auch die Möglichkeit weg zu gehen, sie meinen aber einen "alten Baum" sollte man nicht mehr verpflanzen.
Unser Chauffeur Zucu, der am Sonntag
noch mal nach Piatra-Neamt zurück gefahren ist (wir hatten wichtige Medikamente in Gustis Auto vergessen ), trifft fast pünktlich, trotz Schnee und Glatteis, an der Klinik ein, und weiter geht die Reise nach
Bistritz.
Ich weiß, daß ich mich wiederhole, wenn ich auch hier nur von Klagen und Befürchtungen bezüglich der Reform im Gesundheitswesen schreibe. Man bittet uns, der Klinik und den Bedürftigen auch weiterhin
die Treue zu halten. Der Glaube an eine Verbesserung der miserablen Lebensbedingungen in der Zukunft ist nicht mehr zu spüren, man hat in den 10 Jahren der Talfahrt die Hoffnung verloren. Auch Dana, die Tochter von
Herrn Dr. Suteu ist total verzweifelt. Sie kommt mit der neuen Regelung der Privatisierung der bisher staatlich geleiteten Praxis nicht zurecht. Zwischen den Gesprächen machen wir mit Herrn Dr. Suteu einen
Stadtbummel und man kann ahnen, wie schön die Stadt früher einmal war. Man hat viele alte Gebäude abgerissen und diese durch häßliche Wohnblocks ersetzt. Viele Leute seien damals vom Land in die Stadt gezogen um
hier zu arbeiten. Heute sind sehr viele arbeitslos und verarmt. Besonders alte Menschen trifft man immer wieder, die völlig verwahrlost und abgestumpft durch die Straßen laufen und Müllgefäße nach Eßbarem
durchsuchen. Herr Theiß vom Forum der Deutschen weiß auch nur vom Kampf ums Überleben zu berichten, doch ohne Hilfe von außen (Ausland) sei dies fast unmöglich.
Beladen mit vielen Sorgen, Hoffnungen und Wünschen
treten wir die Rückreise nach Piatra- Neamt an. Die wunderschöne Fahrt über die leicht mit Schnee bedeckten Karpaten, läßt den Druck auf unserer Seele etwas weichen. Wir wollen Uschi noch die wunderschönen Klöster
im Kreis Neamt zeigen, damit sie nicht nur negative Eindrücke nach Hause bringt. Zucu blickt besorgt auf seine Tankuhr, er hatte vergessen in Bistritz den Tank zu füllen, und wir haben noch eine Strecke von 60 km
vor uns liegen. Weit und breit kommt keine Tankstelle, doch endlich, wir sind erleichtert. Leider gibt es kein Benzin - geschlossen -, steht auf einem Zettel, der an der Zapfsäule hängt. Dieses Spielchen wiederholt
sich immer wieder, und langsam werden wir sehr unruhig. Der Gedanke hier in der Wildnis irgendwo stehen bleiben zu müssen, ist gar nicht einladend, es schneit und ist sehr kalt. Zucu hat noch zwei Liter Reserve in
einer Limonadenflasche, aber das genügt nicht. Endlich finden wir eine Zapfsäule, die die "Rettung" bringt. Wir tanken das Nötigste, Zucu befürchtet, das es sich hier nicht um reines Benzin, sondern eher
um ein minderwertiges Gemisch handelt. Die Freude auf die Klöster ist uns etwas vergangen, außerdem sind wir durchgefroren. Wir fahren noch nach Agapia, sehen aber von der prachtvollen Kirche fast nichts, da die
Renovierungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Leider ist auch das Museum geschlossen.
Gusti erwartet uns schon, sie hatte ein tolles Essen vorbereitet, und wir sind auch hungrig. Noch einen Tag haben wir,
dann geht es auf die Heimreise. Ein Gespräch mit Herrn Dr. Curelaru vom Krankenhaus Piatra-Neamt steht am Mittwoch noch auf dem Plan. Man spricht über die derzeitige Situation und bedankt sich für die große Hilfe.
Eine sehr couragierte Ärztin stellt uns noch einige Patienten vor, die ihr sehr am Herzen liegen. Mit wenigen Mitteln versucht man hier Schwerstverletzte und Verbrennungsopfer zu versorgen. Wer den Anblick nicht
gewohnt ist, hat schon ein paarmal zu schlucken. Natürlich müssen wir unbedingt noch den Kindergarten Nr. 4 besuchen, der von Frau Ana Ciutea vorbildlich geführt wird. Die Kinder erwarten uns schon und singen zur
Begrüßung ein paar Lieder. Stolz zeigt man uns die Wäscherei, wo die beiden von uns gebrachten Waschmaschinen und die Bügelmaschine in Betrieb sind. Zum Abschied lädt uns Frau Ana und ihr Mann, der Direktor einer
Fischzucht ist, zum Fischessen ein. Wegen des schlechten Wetters können wir uns leider nicht am See aufhalten, aber es ist sehr gemütlich, wir sehen den Pfarrer von Talba noch einmal und Rosa ist auch in unsrer
Mitte.
Die Zeit des Abschiednehmens ist gekommen, es ist grau und regnerisch an diesem Morgen, als sich der Zug in Richtung Bukarest in Bewegung setzt. "Nicht weinen, liebe Gusti, wir sehen uns ja bald
wieder, im Januar in Moldavien."
Durch die regennassen Scheiben kommt mir alles noch verfallener und verlassener vor. Riesige Fabrikgebäude, in der sich keine Menschenseele mehr aufhält, verrostete
Eisenbahnwagen, kaputte Häuser, auf den abgeernteten Maisfeldern ein Rudel herrenloser Hunde, und auf den Bahnsteigen traurig aussehende Menschen, die sich an dem überall herumliegenden Müll nicht stören.
Das ist
das Bild von einem heruntergekommenen Land, die Hinterlassenschaft eines Regimes, das sich der eine oder andere wieder zurückwünscht. Immerhin hatte man damals etwas zu essen, sagen viele. Es wird leider vergessen,
wie es auch damals um die Kinderheime, und besonders um geistig und körperlich Behinderte stand. Zumindest werden diese bedauernswerten Geschöpfe heute nicht mehr versteckt, man hat die Möglichkeit von unsrer Seite
zu helfen.
Es liegt nicht in unseren Möglichkeiten das Elend zu beenden, aber nur einem Bedürftigen die Hand zu reichen, bedeutet ein Stück des Himmels.
Im November 1999 Ursula Honeck
|